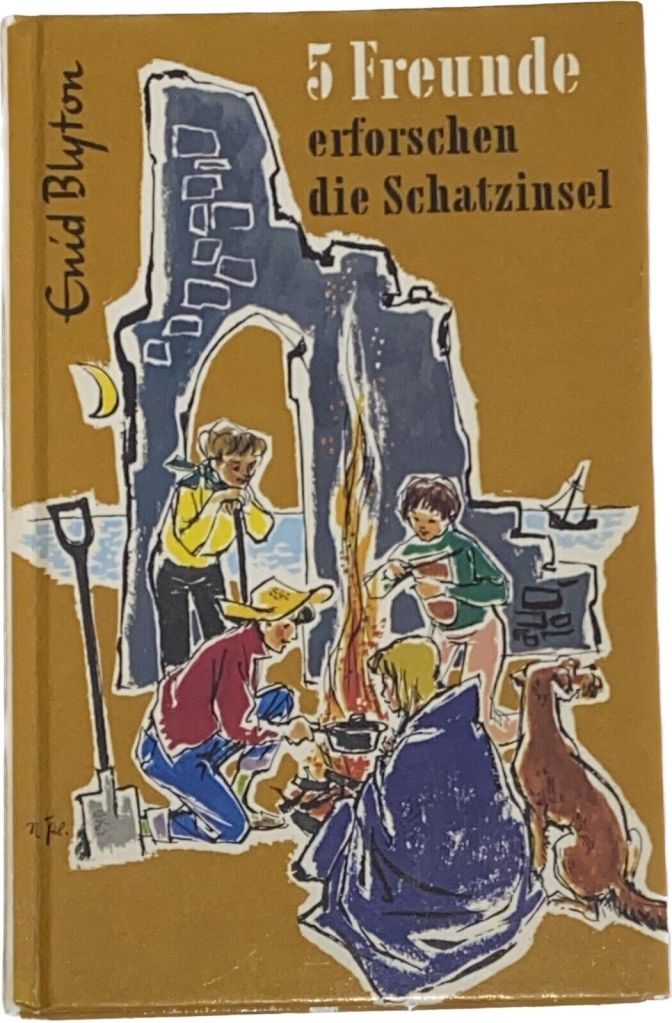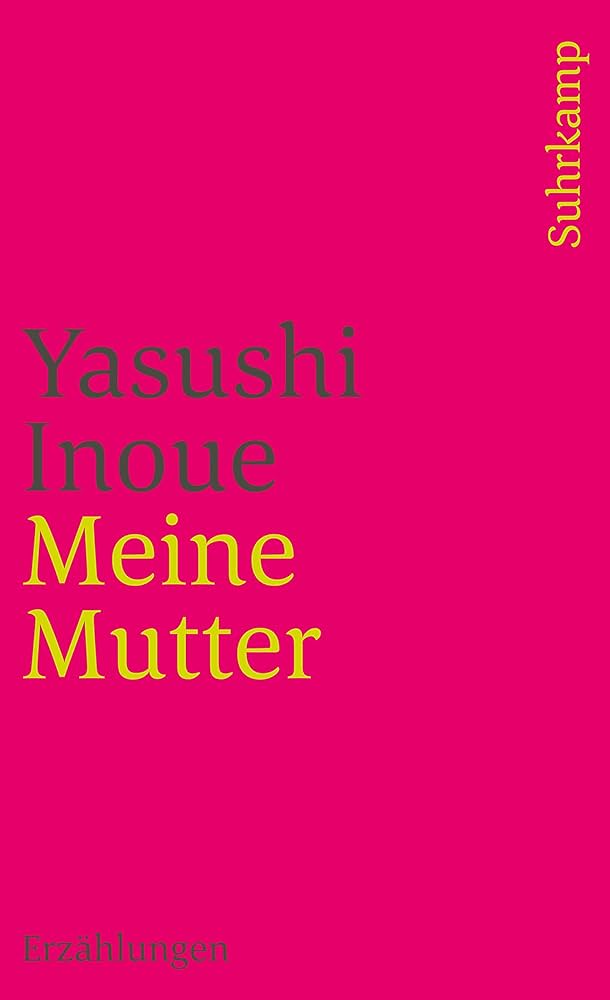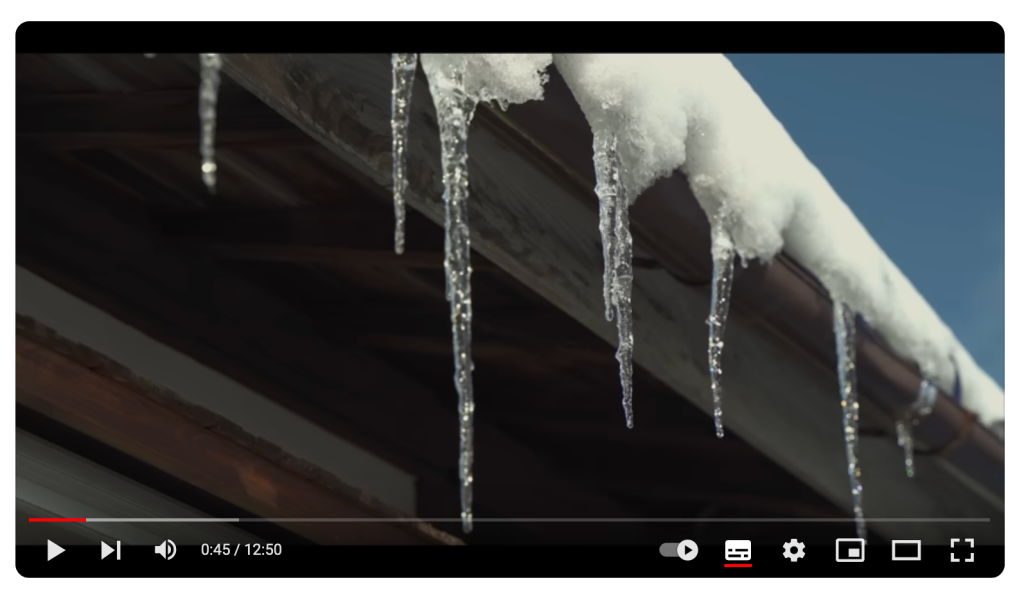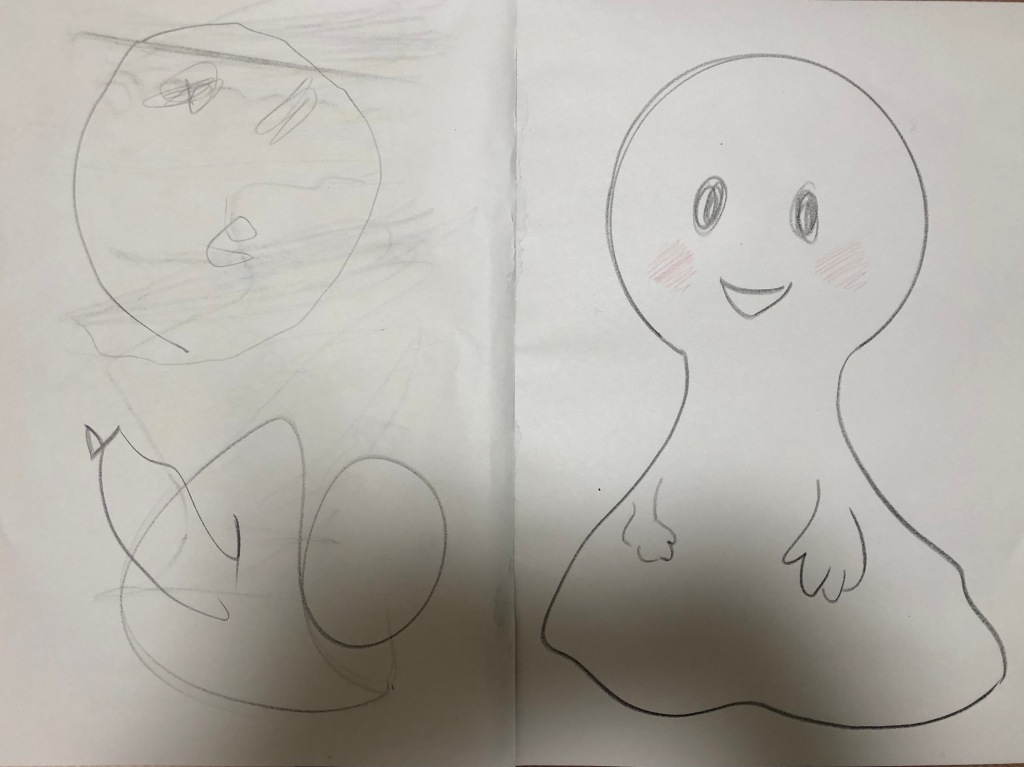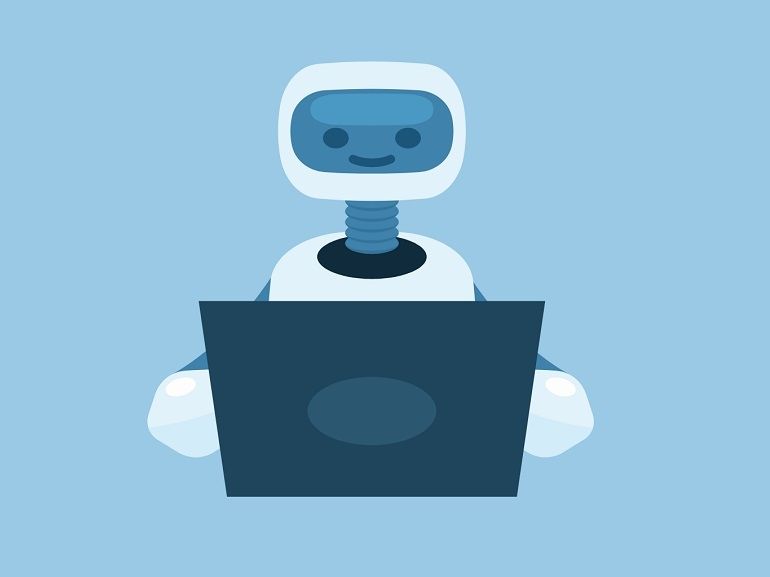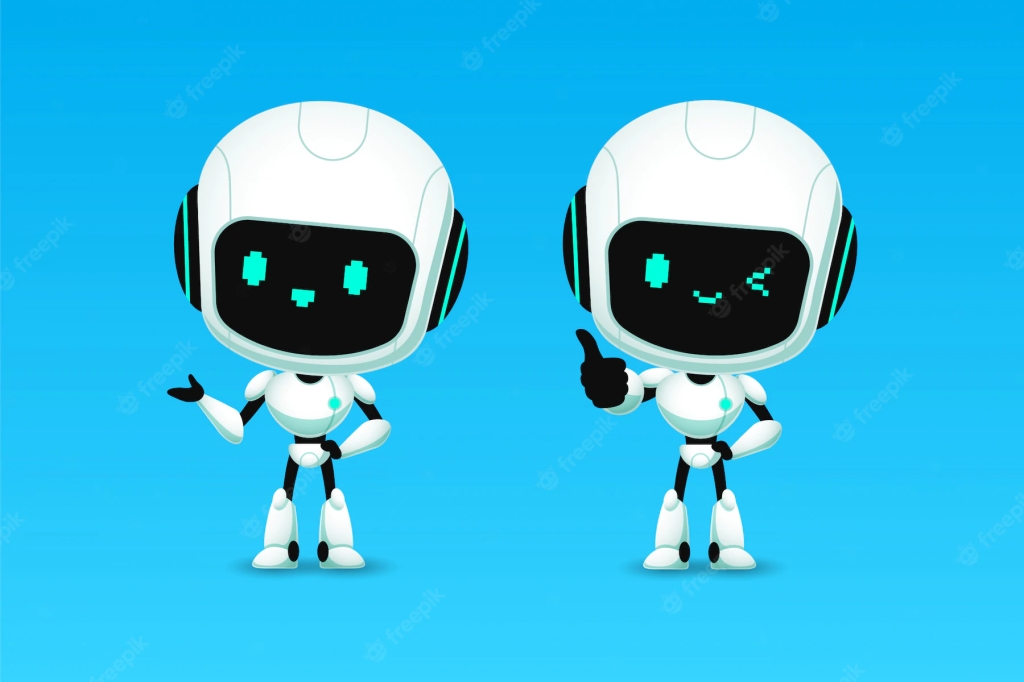Dass Fiktionen die Funktion haben, das bewusste Leben über die Grenze zum Tod hinaus zu dehnen, bezeugen die Mythen, Märchen und die Geistergeschichten. Dass Bewusstsein auch an der Grenze zum Schlaf nicht haltmachen will, bezeugen ebenso unzählige Traumerzählungen.
Mich langweilt die poetische Rhetorik der Traumdarstellung in Literatur oder Film meist. Leuten, die von einem Traum berichten in der einwärtsgewandten (nicht expressiven), das eigene Befremden wie eine dunkle Kellertreppe hinuntertappenden Indirektheit dieser vom Körper nicht recht vorgesehenen Anamnese, höre ich dagegen gern zu.
Bei kulturellen Produkten sind mir lieber als träumende Mitmenschen solche, die wach bleiben. Schon als Kind genoss ich es besonders, wenn die Fünf Freunde von Enid Blyton oder die Drei ??? zur Aufklärung eines der Kriminalfälle nachts ein Haus, ein Boot im Hafen oder den Eingang einer Höhle beobachten mussten.
Ich las in diesen Jahren oft wörtlich, bis mir die Augen zufielen, und der Sieg der fiktiven Held*innen über den Schlaf tröstete über die unausweichliche eigene Niederlage (dass sie wach blieben, war in gewisser Weise viel heroischer als die mehr oder weniger gekonnt inszenierten Lösungen der moderat spannenden Rätsel).
In einigen der japanischen Romane, die mich später begeisterten – Yasushi Inoues Waga haha no ki zum Beispiel – erschien mir die Totenwache auf ähnliche Weise attraktiv. Mein Glück, mittels einiger Sätze im Körper einer Tochter oder eines Sohnes die Nacht durchwachen zu dürfen, während die Welt ringsumher in ihren gewohnten dumpfen Schlummer versank, unterdrückte jeden Gedanken an die Traurigkeit des Anlasses und den Horror, Stunde um Stunde allein im Zimmer mit einer Leiche verbringen zu müssen, die bis eben noch deine Mutter war.
Soweit ich es erinnere, betont Inoue die Mühen, sich um die alte, gebrechliche, aber eigensinnige Mutter zu kümmern, schildert die Spannungen, zu denen die ungleiche Verteilung dieser anstrengenden Arbeit in der Familie führt. Auch nach dem Tod, der aus der Pflegehölle erlöst, geht es doch strapaziös weiter. Mir entgingen diese Aspekte damals also keineswegs.
Dennoch trübt das Mitempfinden von Mühe, Erschöpfung, Frustration, Groll auf andere und Selbstvorwürfen mein Vergnügen an dieser langen schlaffreien Nacht kein bisschen. Ich frage mich, ob meine Reaktion weniger selig ausfiele, wenn ich die Passage nach dem Tod meiner eigenen Mutter nun wiederläse. Ich glaube nicht.
Auf YouTube finde ich das Video eines Spaziergangs durch den Schnee in Kamakura morgens um vier Uhr. Auf den Straßen nahe dem Bahnhof Wadazuka, wo selbst nachts dann und wann ein Auto durchfährt, handelt es sich eher um Matsch, und erst am Strand gleitet die Kamera über eine dünne gleichmäßige Schneedecke. Aber dass da jemand sich auf den Weg gemacht hat in dieser Stunde, die feuchtkalte Luft atmet – das tut, was ich mit Gewissheit verschlafen hätte, wäre ich im Februar, als der seltene Schnee fiel, in Tokyo gewesen –, sichert diesem Video mein Wohlwollen.
The city that never sleeps – die Vorstellung, in der Großstadt zu jeder Tages- und Nachtzeit hinreichend viele Menschen in der Nähe zu wissen, die wach sind und gewissermaßen das Wachen übernehmen wie in spontaner, naturwüchsiger Arbeitsteilung, wirkte auf mich stets beruhigend (solange die Wachen nicht meine Nachbarn waren und Krach machten).
Während die Existenz von Wächtern vor tatsächlich drohenden Gefahren, die Polizei oder das Militär, eher die Ängste wachkitzelt, wenn etwas sie einmal in die Aufmerksamkeit drängt, helfen diese Nacht- und Morgenschwärmer meinem Imaginären, einen Körper zu bewohnen, der gewissen Rhythmen unterworfen ist.
Sie verrichten ihren Dienst in der Anonymität, wie das Nebeneinanderleben zu Millionen sie bietet. Ich muss niemanden von ihnen kennen oder lokalisieren. Die Frage „Who’s there?“, die das Theater und seine Gespensterauftritte in Gang setzt, geht mir am Arsch vorbei oder unter dem Rücken durch, der sich wohlig in die Matratze drückt und die Notwendigkeit des Aufstehens verneint.
An den Videos der Spaziergangsdokumentarist*innen schätze ich, dass sie unbekannt bleiben, ihr Gesicht zuverlässig hinter der Kamera lassen. Nur eine Speiche ihres Schirms ragt ab und zu für einige Sekunden ins Bild.
An Schillers Dom Karlos gefiel mir, als ich im Studium für ein Seminar ein Referat dazu vorbereitete, am besten die Szene, da der König – kurz traumverloren, da er aufschreckt – sich über die eingeschlafenen Pagen in seinem Schlafzimmer beschwert: „Wacht denn hier niemand als der König?“
Es ist auf dieser Szene ebenfalls vier Uhr, Schwellenstunde zwischen Nacht und Morgen. Schiller teilt die Zustände hälftig: der König „von oben herab halb ausgekleidet“; stehend, aber doch „einen Arm über den Sessel gebeugt“; geistesabwesend, doch sprechend; die Pagen „auf den Knien eingeschlafen“.
Die Rolle desjenigen, der als Einziger kein Auge schließt, entspräche der Legitimierung des Souveräns als Wächter des Staates, dessen Bürger*innen ihre private Nachtruhe genießen dürfen, weil sie die politische Macht an den Richtigen abgetreten haben. Doch ein Souverän, der wettert, weil seine Dienerschaft so menschlich reagiert wie die Übrigen im Land – und der mit diesem Vorwurf den Ärger bemäntelt, selbst so weit weggedämmert zu sein, dass ihn die Uhrzeit überrascht –, offenbart eine mehr als persönliche Schwäche.
Es passt da was schlecht im Konzept der Alleinherrschaft: Vom doppelten Körper des Königs ist einer, der wichtigere, immer wieder für Phasen unbeaufsichtigt, da der andere schläft. Der Wächter über alle kann sich nicht selber bewachen. Er ist dafür auf Unterstützung angewiesen.
Doch wo die sich aus Dienern rekrutiert, die kein eigenes Management des Abwechselns unterhalten können, weil ihre Anwesenheit wie ein Schatten am Wandeln des Autokraten hängt, mutet die fatale Zeitschwachstelle des Potentaten seinem Gefolge ein noch übermenschlicheres Durchhalten zu.
Das scheitert früher oder später, wahrscheinlich gerade in einer kritischen Situation. Das synchrone Ermüden der Pagen – Knaben zumal, deren Väter der Herrscher hinrichten ließ – zeigt, wie die monarchische Zentralisierung des Wächtertums eine zweckmäßige Verteilung der Wach- und Schlafzeiten verunmöglicht. Die Stadt schafft mühelos, was den Palast überfordert.